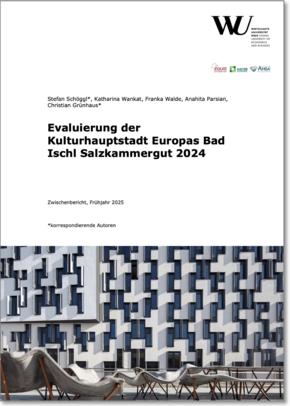Neues aus der Forschung
Inhalt dieses Kapitels
- Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact | Zwischenbericht der Evaluierung der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024
- Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact | Endbericht zur begleitenden Evaluierung des Programms Wohnschirm freigegeben.
- Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact | Workshop zu Wirkungsmessung im Filmfestivalsektor
- Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact | Podcast Inside Impact: Schwerpunkt zu sozialen Innovationen
- Institut für Public und Nonprofit Management (JKU) | Bericht vom internationalen Kolloquium „Transparency in Action"
- Uni Graz | Wettbewerb um den Erwerb gebrauchter Kleidung zwischen Wohltätigkeitsorganisationen und gewinnorientierten Organisationen
Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact | Zwischenbericht der Evaluierung der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024

Das Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact führt die offizielle Evaluierung der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024 (KHST24) durch. Ziel ist es, den gesellschaftlichen Gesamtnutzen der Kulturhauptstadt zu analysieren. Dabei kommt eine partielle Social Return on Investment (SROI)-Analyse zum Einsatz. Der Endbericht wird Anfang 2026 publiziert, erste Zwischenergebnisse liegen schon jetzt vor und wurden Ende März 2025 in einem Zwischenbericht veröffentlicht sowie bei der Abschluss-Pressekonferenz der Kulturhauptstadt vorgestellt, im Beisein des oberösterreichischen Landeshauptmanns Thomas Stelzer, des steirischen Landesrats für Kultur Karlheinz Kornhäusl, der Bad Ischler Bürgermeisterin Ines Schiller, Theresia Niedermüller vom Bundesministerium für Kunst und Kultur sowie den Zuständigen der Kulturhauptstadt und der interessierten Öffentlichkeit.
Das Forschungsteam errechnete die finale Zahl an Projekten (314, davon: 117 assoziierte Projekte, 133 Trägerschaftsprojekte, 64 Eigenprojekte) sowie an Besuchen (824.518, davon: 534.659 bei Eigen- und Trägerschaftsprojekten, 289.859 bei assoziierten Projekten). Die Kulturhauptstadt hatte erheblichen Einfluss auf die Projektträger*innen.
Viele hätten ihr Projekt ohne die Unterstützung der KHST24 nicht (45 %) oder nicht im selben Ausmaß (51 %) realisieren können. Besonders profitierten sie von regionaler Vernetzung (85 % der Projekte) und Weiterentwicklung in der Kunst- und Kulturarbeit (78 % der Projekte). Zudem erhöhte sich ihre Sichtbarkeit, vor allem regional (94 % der Projekte).
Fast die Hälfte der Projekte (46 %) plant eine Fortführung über 2024 hinaus, was auf eine nachhaltige Wirkung der KHST24 schließen lässt.
Desweiteren führte die Kulturhauptstadt zu einer umfangreicheren Steigerung der Tourismuszahlen im Vergleich zu anderen Regionen, sowohl bei Ankünften (Region: + 4,1 %, Bad Ischl: + 17,5 %, Ö-Schnitt: + 3,3 %) als auch bei Nächtigungen (Region: + 3,7 %, Bad Ischl: + 16,3 %, Ö-Schnitt: + 2,1 %). Die Kulturhauptstadt wurde von Besucher*innen überwiegend positiv bewertet (7 von 10 Punkte) und weckte bei der regionalen Bevölkerung und den Tourist*innen ein stärkeres Interesse an Kulturveranstaltungen. Sie trug weiters zur kulturellen Entwicklung und Attraktivitätssteigerung der Region bei. Auch eine bessere Erreichbarkeit von Kunst- und Kulturangeboten und die Qualität der Programmgestaltung wurden positiv hervorgehoben. Kritisch angemerkt wurde beispielsweise, dass regionale und traditionelle Aspekte im Programm zu kurz kamen. Zusammenfassend setzte die KHST24 wichtige Impulse für kulturelle und infrastrukturelle Entwicklungen in der Region und hatte einen positiven wirtschaftlichen Effekt. Trotz eines vergleichsweise geringen Budgets konnten zahlreiche qualitativ hochwertige Projekte realisiert werden, die ohne die Kulturhauptstadt nicht möglich gewesen wären.
Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact | Endbericht zur begleitenden Evaluierung des Programms Wohnschirm freigegeben.

Das Programm Wohnschirm des Sozialministeriums startete im März 2022 mit dem Ziel, Menschen zu unterstützen, die durch die Covid-19-Pandemie finanziell in Bedrängnis gekommen sind und dadurch Probleme hatten, ihre Miete zu begleichen. Mietrückstände sind sogenannte „gefährliche Schulden“, weil Vermieter:innen nach dem Mietrecht bereits beim ersten Zahlungsverzug die Möglichkeit haben, bei Gericht eine Delogierung zu beantragen. Eine Delogierung hat weitreichende Auswirkungen auf die betroffenen Personen und die Beschaffung einer neuen Wohnung ist mit hohen Kosten verbunden, welche die finanzielle Situation der Betroffenen noch zusätzlich belasten.

Der Wohnschirm wurde als ein Kriseninstrument des Sozialministeriums eingeführt und war zunächst dafür bestimmt, die Folgen der Covid-19-Pandemie abzuschwächen und so Delogierungen zu verhindern. Er war ursprünglich mit 24 Millionen Euro ausgestattet und bis Ende 2023 vorgesehen. Bereits im Jahr 2022 folgte mit der inflationsbedingten Teuerung jedoch eine weitere Krise, die die finanzielle Situation der privaten Haushalte zusätzlich stark belastete. Folglich wurde der Wohnschirm in dreifacher Hinsicht ausgeweitet, erstens, in Bezug auf die Art der unterstützten Kosten, neben Mietrückständen können auch Energiekostenrückstände eingereicht werden. Zweitens wurde die Laufzeit bis Ende 2026 verlängert und drittens, wurde das Volumen des Wohnschirms stark erweitert.
Das NPO Kompetenzzentrum wurde vom Sozialministerium beauftragt, das Programm Wohnschirm durch eine externe Evaluierung zu begleiten.
Der Endbericht wurde nun freigegeben und ist abrufbar unter:
https://www.wu.ac.at/npocompetence/projekte/2024/evaluierung-wohnschirm
oder auf der Homepage des Sozialministeriums:
https://www.sozialministerium.gv.at/Themen/Soziales/Soziale-Themen/wohnungssicherung.html
Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact | Workshop zu Wirkungsmessung im Filmfestivalsektor

Filmfestivals sind lebendige Kulturorte. Jenseits der Leinwand entfalten sie vielfältige gesellschaftliche Wirkungen: Sie inspirieren, vernetzen, bilden und fördern den kulturellen Austausch. Doch ihr gesellschaftlicher Mehrwert bleibt oft unbeleuchtet. Wie lässt sich dieser Mehrwert konkretisieren und messen, um den Wert von Filmfestivals über reine Besuchszahlen hinaus zu erfassen und ihre Bedeutung für Gesellschaft und Kultur fundiert zu kommunizieren?
Zu diesem Thema gestalteten Christian Grünhaus und Stefan Schöggl vom Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact einen Workshop an der WU, zusammen mit Verena Teissl der FH Kufstein Tirol und Tanja Krainhöfer von Filmfestivalstudien München. Teilnehmende waren Vertreter*innen verschiedener österreichischer Filmfestivals sowie Vertreter*innen der Kulturverwaltung. Sie diskutierten angeregt den Social Impact und Wirkungsmessung von Filmfestivals.
Erste Stakeholder und Wirkungen wurden identifiziert, die von Selbstreflexion beim Publikum, über Netzwerkbildung in der Filmindustrie, der Erschließung neuer Besucher*innengruppen für Kinos bis zur Standort-Attraktivierung auf Regionsebene reichen. Weiters wurden erste Überlegungen zur Messung dieser Wirkungen sowie zu einer wirkungsorientierten Strategiearbeit angestellt.
Zentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Impact | Podcast Inside Impact: Schwerpunkt zu sozialen Innovationen

Beim Podcast Inside Impact dreht sich aktuell alles um soziale Innovationen. In bereits vier Folgen wird das Thema aus mehreren Blickwinkeln betrachtet. Dr. Georg Mildenberger vom CSI Heidelberg erklärt, was eine soziale Innovation (nicht) ist, und spricht über Erfolgsfaktoren und Stolpersteine für Innovationsprojekte. Christian Horak von EY Österreich haben wir gefragt, wie soziale Innovator:innen unterstützt werden können.
Aus der Praxis berichtet Rosa Bergmann, Gründerin der Hobby Lobby, über die Herausforderungen in der Ausbalancierung von Innovation und Stabilität. Schließlich haben wir Richard Lang (Freie Universität zu Bozen) und Philipp Thimm (Universität zu Köln) gefragt welche Rolle Genossenschaften zwischen Tradition und Moderne spielen.
Zu hören auf alle großen Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren! Mehr Informationen zu Inside Impact:
Institut für Public und Nonprofit Management (JKU) | Bericht vom internationalen Kolloquium „Transparency in Action"
Julia Trautendorfer vertrat unser Institut beim internationalen Kolloquium „Transparency in Action – International Perspectives from Experimental Research on Freedom of Information Laws“, das vom 27. bis 28. März 2025 an der Université libre de Bruxelles vom Centre d'Étude des Politiques et de l'Administration Publique (CEPAP) veranstaltet wurde.
Im Laufe von zwei Tagen hat der Workshop untersucht, wie experimentelle Forschung dazu beitragen kann, den gesetzlich garantierten Zugang zu öffentlichen Informationen zu stärken. In einem öffentlichen Vortrag für Teilnehmer und Masterstudenten teilte Julia Einblicke zu Daten aus deutschen FOI-Anfragen und trug zu einer breiteren Diskussion mit Forschern aus Belgien, Italien und dem Vereinigten Königreich bei.
Die Veranstaltung bot auch die Möglichkeit, Forschungsexperimente in Afrika weiter zu entwickeln, insbesondere mit den rechtlichen und praktischen Herausforderungen der Umsetzung der FOI in Uganda und Südafrika.
Uni Graz | Wettbewerb um den Erwerb gebrauchter Kleidung zwischen Wohltätigkeitsorganisationen und gewinnorientierten Organisationen
Am 27. März 2025 fand in Graz ein Vortrag der Uni Graz statt, der sich mit der Konkurrenz von Wohltätigkeitsorganisationen und gewinnorientierten Organisationen um gebrauchte Kleidung beschäftigte.
Wohltätigkeitsorganisationen verfolgen oft soziale Ziele, während gewinnorientierte Unternehmen sich auf die Erzielung von Einnahmen aus dem Verkauf gebrauchter Kleidung konzentrieren. Dieser Wettbewerb kann Faktoren wie die Art der gespendeten Kleidung, die Methoden der Spendensammlung und die eingesetzten Preisstrategien beeinflussen. Dazu sind folgende Punkte zu betrachten:
Marktgröße und -struktur
Laut einer von ScienceDirect veröffentlichten Studie beeinflusst der Gesamtmarkt für gebrauchte Kleidung in Graz, der sowohl Wohltätigkeitsorganisationen als auch gewinnorientierte Unternehmen umfasst, die Wettbewerbsfähigkeit dieser Organisationen.
Ziele von Wohltätigkeitsorganisationen
Wohltätigkeitsorganisationen nehmen möglicherweise eher Spenden von minderwertiger Ware an, da sie oft von sozialen Zielen motiviert sind, z. B. der Unterstützung von Bedürftigen oder der Beschaffung von Spenden für ihren Zweck.
Ziele von gewinnorientierten Organisationen
Gewinnorientierte Unternehmen bevorzugen möglicherweise Artikel, die in gutem Zustand sind und gewinnbringend verkauft werden können. Sie setzen möglicherweise auch häufiger Marketing- und Werbestrategien ein, um Kunden zu gewinnen und den Umsatz zu steigern.
Wettbewerb um Spenden
Wohltätigkeitsorganisationen und gewinnorientierte Unternehmen konkurrieren möglicherweise auf verschiedene Weise um Spenden, beispielsweise durch Haus-zu-Haus-Sammlungen, Sammelbehälter und Partnerschaften mit lokalen Unternehmen.
Preisstrategien
Gewinnorientierte Unternehmen können Preisstrategien verfolgen, die Faktoren wie die Anschaffungskosten der Kleidung, die Gemeinkosten und die Nachfrage nach ähnlichen Produkten berücksichtigen. Wohltätigkeitsorganisationen haben möglicherweise mehr Flexibilität bei der Preisgestaltung, da sie nicht primär auf Gewinn ausgerichtet sind.